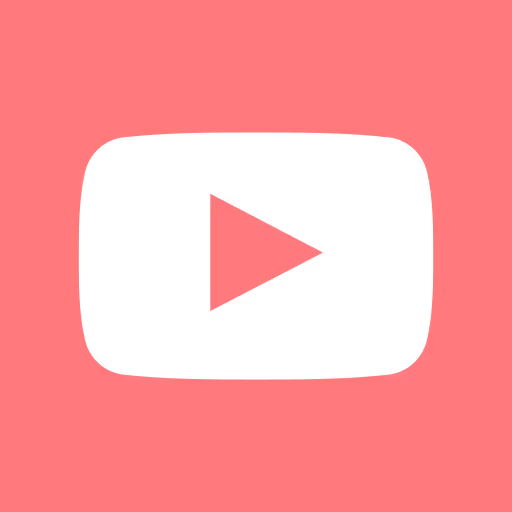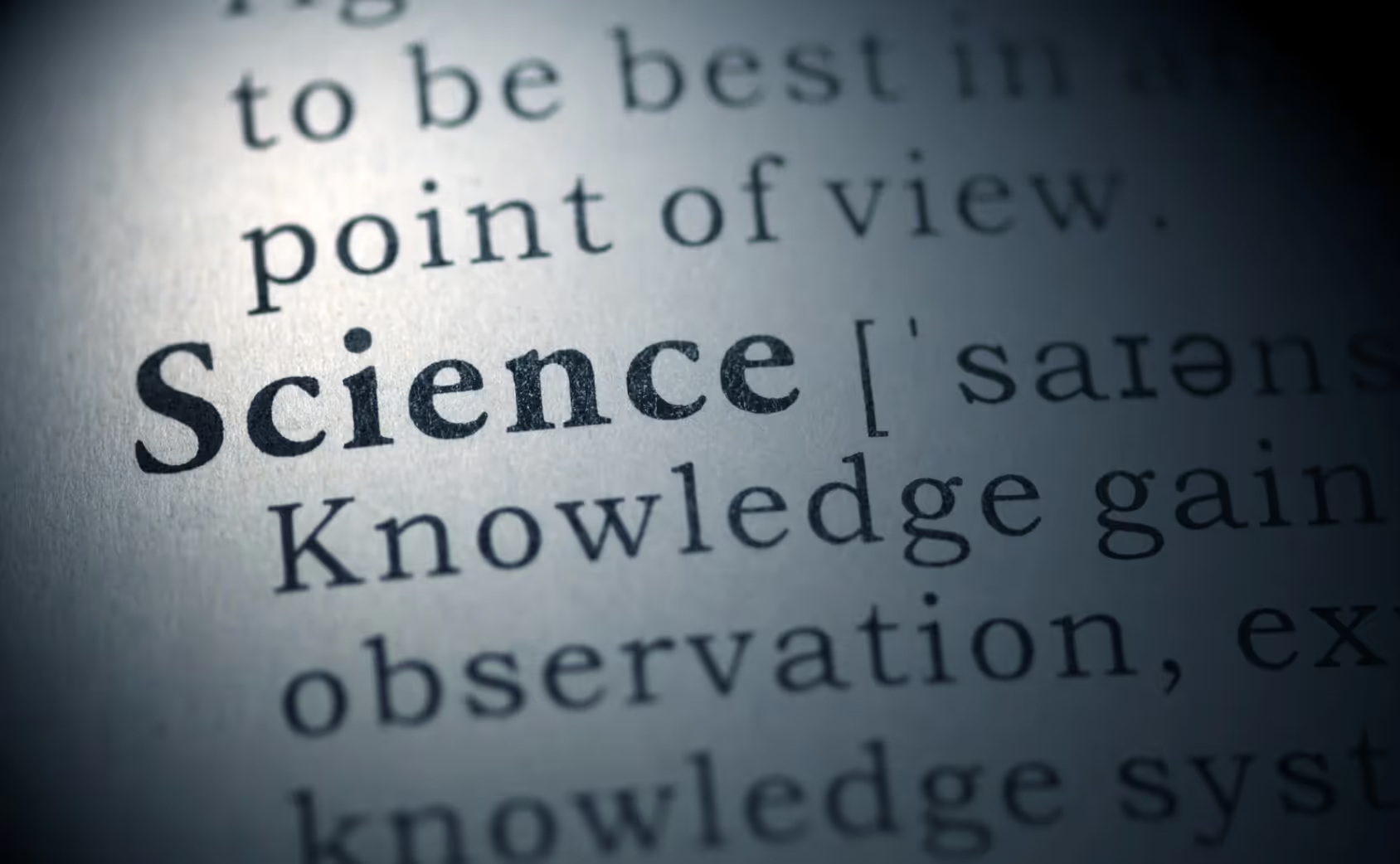Anne Graefer – November 12, 2025
Cultural Bias in der Wissenschaft
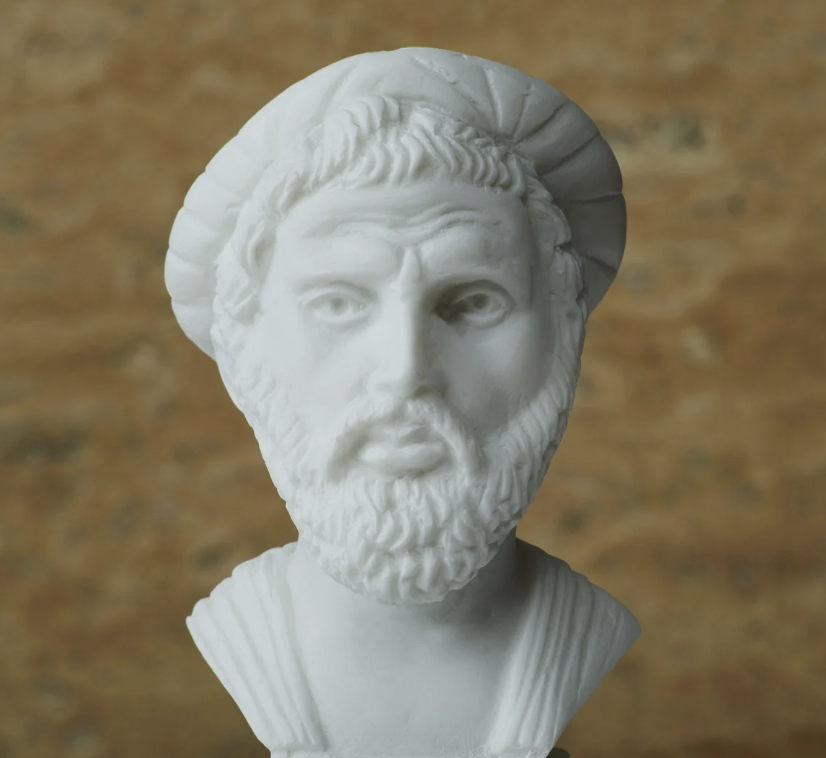
Wissenschaft gilt als rational, objektiv und universell. Doch selbst in den vermeintlich neutralsten Disziplinen wie Mathematik oder Physik wirken kulturelle Prägungen und systematische Verzerrungen, sogenannte Cultural Biases. Sie beeinflussen, welche Fragen gestellt, welche Erkenntnisse sichtbar und welche Perspektiven ausgeblendet werden.
Der Begriff „Cultural Bias“ ist zentral, wenn es darum geht, zu verstehen, wie Wissen sozial konstruiert wird. Denn wer als Quelle wissenschaftlicher Autorität gilt, ist selten das Ergebnis reiner Erkenntnis, sondern oft auch Ausdruck historischer und kultureller Machtverhältnisse. Wenn du erfahren möchtest, wie wir wissenschaftliche Organisationen bei der Arbeit an diesen Themen begleiten, findest du mehr zu unseren Trainings und Workshops zu Unconscious Bias in Research & Science.
Was bedeutet „Cultural Bias in der Wissenschaft“?
Cultural Bias bezeichnet die systematische Verzerrung wissenschaftlicher Wahrnehmung und Bewertung durch kulturelle Perspektiven. Er entsteht, wenn Forschende (meist unbewusst) ihre eigenen kulturellen Maßstäbe, Werte oder Erkenntnistraditionen als universell annehmen und andere Traditionen abwerten oder ignorieren. In der Praxis zeigt sich Cultural Bias in vielfältiger Weise:
– in der Geschichtsschreibung der Wissenschaft,
– in Zitationspraktiken,
– in der Zusammenstellung von Forschungsförderung oder Lehrplänen,
und in der Bewertung von Wissen, das außerhalb westlicher Wissenschaftssysteme entsteht.
Die Folge ist ein verzerrtes Bild wissenschaftlicher Entwicklung: Der „globale Westen“ erscheint als Wiege des Wissens, während Erkenntnisse aus Asien, Afrika oder dem arabischen Raum kaum erwähnt werden.
– in der Geschichtsschreibung der Wissenschaft,
– in Zitationspraktiken,
– in der Zusammenstellung von Forschungsförderung oder Lehrplänen,
und in der Bewertung von Wissen, das außerhalb westlicher Wissenschaftssysteme entsteht.
Die Folge ist ein verzerrtes Bild wissenschaftlicher Entwicklung: Der „globale Westen“ erscheint als Wiege des Wissens, während Erkenntnisse aus Asien, Afrika oder dem arabischen Raum kaum erwähnt werden.
Unsichtbare Entdecker: Von Ibn Sahl bis Mādhava von Sangamagrāma
Kaum etwas verdeutlicht Cultural Bias in der Wissenschaft so deutlich wie der Blick in die Geschichte der Mathematik und Physik. Viele Entdeckungen, die heute unter europäischen Namen bekannt sind, wurden Jahrhunderte zuvor in anderen Kulturkreisen formuliert, berechnet oder empirisch beschrieben nur um später „neu entdeckt“ und umbenannt zu werden.
Ein prominentes Beispiel ist das sogenannte Snell’sche Brechungsgesetz, das in der Optik als Grundlage für die Berechnung von Lichtbrechung gilt. Benannt wurde es nach dem niederländischen Physiker Willebrord Snellius (1591–1626). Tatsächlich hatte jedoch der persische Gelehrte Ibn Sahl (um 940–1000) das Prinzip bereits im 10. Jahrhundert am Hof der Abbasiden in Bagdad formuliert – rund 600 Jahre früher.
Ähnlich verhält es sich mit der nach Leonardo Fibonacci (um 1170–1240) benannten Fibonacci-Sequenz, die auf den indischen Mathematiker Pingala (3. Jh. v. Chr.) sowie auf die Arbeiten von Virahanka (6. Jh.), Gopāla (12. Jh.) und anderen indischen Gelehrten zurückgeht. Fibonacci übernahm das Prinzip aus arabischen und indischen Quellen, ohne die ursprünglichen Autor:innen namentlich zu nennen.
Auch das sogenannte Pascal’sche Dreieck war längst bekannt, bevor der französische Mathematiker Blaise Pascal (1623–1662) es populär machte. Der persische Gelehrte Omar Khayyam (um 1048–1131) beschrieb die Struktur bereits im 11. Jahrhundert, der chinesische Mathematiker Yang Hui (um 1261) in seiner Yang Hui Suanfa, und indische Schriften erwähnen ähnliche kombinatorische Prinzipien sogar noch früher.
Selbst der berühmte Satz des Pythagoras ist kein genuin griechisches Konzept. Hinweise auf dieses geometrische Prinzip finden sich bereits in babylonischen Keilschrifttexten (um 1800 v. Chr.) sowie in den mathematischen Papyrusrollen des alten Ägyptens und in indischen Quellen wie der Śulba Sūtra (ca. 800 v. Chr.).
Besonders eindrucksvoll ist schließlich das Beispiel des indischen Mathematikers Mādhava von Sangamagrāma (um 1350–1425), der an der Kerala-Schule der Astronomie und Mathematik wirkte. Mādhava entwickelte präzise Reihenentwicklungen für Sinus, Kosinus und Tangens, Konzepte, die in Europa erst 200 Jahre später durch Newton und Leibniz als Grundlage der Infinitesimalrechnung gefeiert wurden. Seine Arbeiten belegen, dass analytische Methoden und mathematische Innovation nicht auf Europa beschränkt waren, sondern in vielfältigen Wissenskulturen gleichzeitig entstanden.
Diese Beispiele zeigen: Die Art, wie wissenschaftliche Entdeckungen benannt und überliefert werden, ist kein neutraler Akt. Sie folgt historischen Macht- und Deutungslinien, die dazu geführt haben, dass nicht-europäische Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte systematisch marginalisiert oder unsichtbar gemacht wurden.
Ein prominentes Beispiel ist das sogenannte Snell’sche Brechungsgesetz, das in der Optik als Grundlage für die Berechnung von Lichtbrechung gilt. Benannt wurde es nach dem niederländischen Physiker Willebrord Snellius (1591–1626). Tatsächlich hatte jedoch der persische Gelehrte Ibn Sahl (um 940–1000) das Prinzip bereits im 10. Jahrhundert am Hof der Abbasiden in Bagdad formuliert – rund 600 Jahre früher.
Ähnlich verhält es sich mit der nach Leonardo Fibonacci (um 1170–1240) benannten Fibonacci-Sequenz, die auf den indischen Mathematiker Pingala (3. Jh. v. Chr.) sowie auf die Arbeiten von Virahanka (6. Jh.), Gopāla (12. Jh.) und anderen indischen Gelehrten zurückgeht. Fibonacci übernahm das Prinzip aus arabischen und indischen Quellen, ohne die ursprünglichen Autor:innen namentlich zu nennen.
Auch das sogenannte Pascal’sche Dreieck war längst bekannt, bevor der französische Mathematiker Blaise Pascal (1623–1662) es populär machte. Der persische Gelehrte Omar Khayyam (um 1048–1131) beschrieb die Struktur bereits im 11. Jahrhundert, der chinesische Mathematiker Yang Hui (um 1261) in seiner Yang Hui Suanfa, und indische Schriften erwähnen ähnliche kombinatorische Prinzipien sogar noch früher.
Selbst der berühmte Satz des Pythagoras ist kein genuin griechisches Konzept. Hinweise auf dieses geometrische Prinzip finden sich bereits in babylonischen Keilschrifttexten (um 1800 v. Chr.) sowie in den mathematischen Papyrusrollen des alten Ägyptens und in indischen Quellen wie der Śulba Sūtra (ca. 800 v. Chr.).
Besonders eindrucksvoll ist schließlich das Beispiel des indischen Mathematikers Mādhava von Sangamagrāma (um 1350–1425), der an der Kerala-Schule der Astronomie und Mathematik wirkte. Mādhava entwickelte präzise Reihenentwicklungen für Sinus, Kosinus und Tangens, Konzepte, die in Europa erst 200 Jahre später durch Newton und Leibniz als Grundlage der Infinitesimalrechnung gefeiert wurden. Seine Arbeiten belegen, dass analytische Methoden und mathematische Innovation nicht auf Europa beschränkt waren, sondern in vielfältigen Wissenskulturen gleichzeitig entstanden.
Diese Beispiele zeigen: Die Art, wie wissenschaftliche Entdeckungen benannt und überliefert werden, ist kein neutraler Akt. Sie folgt historischen Macht- und Deutungslinien, die dazu geführt haben, dass nicht-europäische Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte systematisch marginalisiert oder unsichtbar gemacht wurden.
Wie Cultural Bias die Wahrnehmung von Wissenschaft prägt
Die systematische Sichtbarkeit westlicher Namen und die Unsichtbarkeit nicht-westlicher Wissensquellen prägen bis heute unser kollektives Verständnis davon, wo Wissen entsteht und wem es gehört. Diese Verzerrung wirkt subtil:
– Sie beeinflusst, welche Quellen Studierende kennenlernen.
– Sie entscheidet mit, wer als intellektuelle Autorität gilt.
- Und sie verstärkt das Bild, dass wissenschaftlicher Fortschritt vor allem ein europäisches Projekt sei.
So entsteht ein kulturell zentrierter Kanon, der globale Vielfalt von Erkenntnistraditionen unsichtbar macht.
Diese Verzerrung wirkt nicht nur retrospektiv, sondern auch aktuell in Forschungsförderung, Peer Reviews und internationalen Rankings: Publikationen aus westlichen Institutionen werden häufiger zitiert, während Forschende aus dem Globalen Süden weniger Sichtbarkeit erhalten, unabhängig von der Qualität ihrer Arbeit.
– Sie beeinflusst, welche Quellen Studierende kennenlernen.
– Sie entscheidet mit, wer als intellektuelle Autorität gilt.
- Und sie verstärkt das Bild, dass wissenschaftlicher Fortschritt vor allem ein europäisches Projekt sei.
So entsteht ein kulturell zentrierter Kanon, der globale Vielfalt von Erkenntnistraditionen unsichtbar macht.
Diese Verzerrung wirkt nicht nur retrospektiv, sondern auch aktuell in Forschungsförderung, Peer Reviews und internationalen Rankings: Publikationen aus westlichen Institutionen werden häufiger zitiert, während Forschende aus dem Globalen Süden weniger Sichtbarkeit erhalten, unabhängig von der Qualität ihrer Arbeit.
Warum Cultural Bias kein moralisches, sondern ein strukturelles Thema ist
Cultural Bias ist kein individuelles Fehlverhalten, sondern das Ergebnis historischer und institutioneller Strukturen. Die europäische Wissenschaftsgeschichte hat über Jahrhunderte hinweg ihre eigene Perspektive als universell gesetzt. Viele Lehrpläne, Zitationssysteme und Förderlogiken beruhen noch immer auf diesem Erbe. Das Ziel ist also nicht, Schuld zuzuweisen, sondern:
– Mechanismen zu verstehen,
– Diversität als Erkenntnisressource zu begreifen,
- und Forschung gerechter, inklusiver und globaler zu gestalten.
Das erfordert Bewusstsein – aber auch konkrete Maßnahmen.
– Mechanismen zu verstehen,
– Diversität als Erkenntnisressource zu begreifen,
- und Forschung gerechter, inklusiver und globaler zu gestalten.
Das erfordert Bewusstsein – aber auch konkrete Maßnahmen.
Wege zu einer diversitätsbewussten Wissenschaftskultur
Wie können Universitäten und Forschungseinrichtungen Cultural Bias aktiv entgegenwirken? Erfahrungen aus meiner Arbeit mit wissenschaftlichen Institutionen zeigen vier zentrale Handlungsfelder:
1. Reflexion fördern
Schulungen zu Unconscious Bias und Cultural Bias in der Wissenschaft helfen Forschenden, eigene Wahrnehmungsmuster zu erkennen. Solche Trainings müssen jedoch mehr leisten als reine Sensibilisierung. Sie sollten Reflexion mit strukturellen Veränderungen verbinden.
2. Lehrpläne dekolonisieren
Lehrmaterialien sollten globale Wissensbeiträge sichtbar machen und Studierende befähigen, wissenschaftliche Erkenntnis als kulturell eingebetteten Prozess zu verstehen.
3. Zitationspraktiken überdenken
Bewusste Diversifizierung von Quellen und Autor:innen stärkt wissenschaftliche Qualität und Perspektivenvielfalt.
4. Strukturelle Anreize schaffen
Förderinstitutionen und Hochschulen können durch Kriterien wie Diversity Impact oder Inclusive Research Design dazu beitragen, Cultural Bias systematisch abzubauen.
1. Reflexion fördern
Schulungen zu Unconscious Bias und Cultural Bias in der Wissenschaft helfen Forschenden, eigene Wahrnehmungsmuster zu erkennen. Solche Trainings müssen jedoch mehr leisten als reine Sensibilisierung. Sie sollten Reflexion mit strukturellen Veränderungen verbinden.
2. Lehrpläne dekolonisieren
Lehrmaterialien sollten globale Wissensbeiträge sichtbar machen und Studierende befähigen, wissenschaftliche Erkenntnis als kulturell eingebetteten Prozess zu verstehen.
3. Zitationspraktiken überdenken
Bewusste Diversifizierung von Quellen und Autor:innen stärkt wissenschaftliche Qualität und Perspektivenvielfalt.
4. Strukturelle Anreize schaffen
Förderinstitutionen und Hochschulen können durch Kriterien wie Diversity Impact oder Inclusive Research Design dazu beitragen, Cultural Bias systematisch abzubauen.
Fazit: Wissenschaft ist global und Wissen entsteht überall
Cultural Bias erinnert uns daran, dass Wissenschaft kein neutraler, sondern ein kulturell geformter Prozess ist. Er zeigt, dass Objektivität nur dann möglich ist, wenn wir unsere eigenen Perspektiven kritisch reflektieren und Wissen als ein gemeinsames, globales Projekt verstehen.
Die Erkenntnisse über Cultural Bias eröffnen daher nicht nur historische Einsichten, sondern auch eine zentrale Zukunftsfrage: Wie kann Wissenschaft inklusiver, vielfältiger und gerechter werden?
Mit GenderIQ unterstütze ich Universitäten und Forschungsinstitute dabei, Cultural und Unconscious Bias zu erkennen, Strukturen zu verändern und Diversität als Stärke wissenschaftlicher Exzellenz zu begreifen.
👉 Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Ihre Institution Bias in Forschung und Führung sichtbar machen kann, freue ich mich über Ihre Kontaktaufnahme.
Die Erkenntnisse über Cultural Bias eröffnen daher nicht nur historische Einsichten, sondern auch eine zentrale Zukunftsfrage: Wie kann Wissenschaft inklusiver, vielfältiger und gerechter werden?
Mit GenderIQ unterstütze ich Universitäten und Forschungsinstitute dabei, Cultural und Unconscious Bias zu erkennen, Strukturen zu verändern und Diversität als Stärke wissenschaftlicher Exzellenz zu begreifen.
👉 Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Ihre Institution Bias in Forschung und Führung sichtbar machen kann, freue ich mich über Ihre Kontaktaufnahme.
Arbeiten Sie mit uns!
Das sagen unsere Kund*innen

"Providing valuable know-how and hands-on measures."
Würth Group
Robert Friedmann
Chairman of the Board
Chairman of the Board

"Anne implemented our global Unconscious Bias initiative."
Vaillant Group
Sevkan Bolu
Global HR Manager
Global HR Manager

"Bewegt selbst kritische Stimmen zu Reflexion und Umdenken."
Max-Planck-Gesellschaft
Frauke Logermann
Team Lead Talent
Team Lead Talent
Unser Prozess
Auf einen Blick
1
Kontakt aufnehmen
Schreiben Sie uns per E-Mail, rufen Sie uns an oder buchen Sie direkt ein Vorgespräch.
2
Angebot erhalten
Webinar, Präsenztraining, Vortrag oder eLearning – wir erstellen Ihr maßgeschneidertes Angebot.
3
Optimal vorbereitet starten
Zwei Wochen vor dem Training erhalten Sie Vorbereitungsmaterial für alle Teilnehmenden.
4
Training erleben
Praxisnah und interaktiv – lernen Sie mit uns auf Deutsch oder Englisch, online oder in Präsenz.
5
Nachbereitung & Debriefing
Sie erhalten ein Management Summary und wir definieren zusammen nächste Schritte.
Jetzt anfragen →







.svg)








.avif)
.avif)