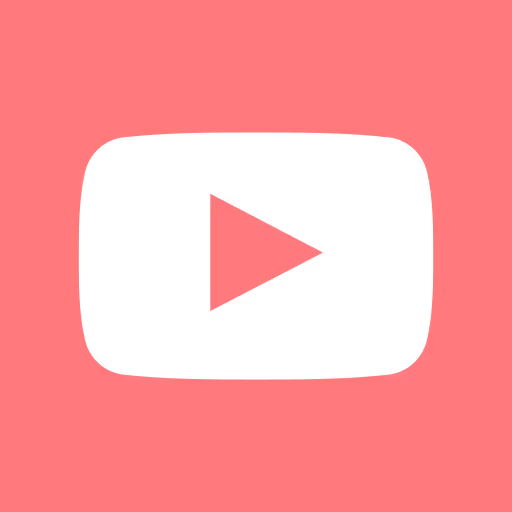Anne Graefer – Januar 9, 2026
Unconscious Bias: Vorurteile haben doch immer nur die anderen!
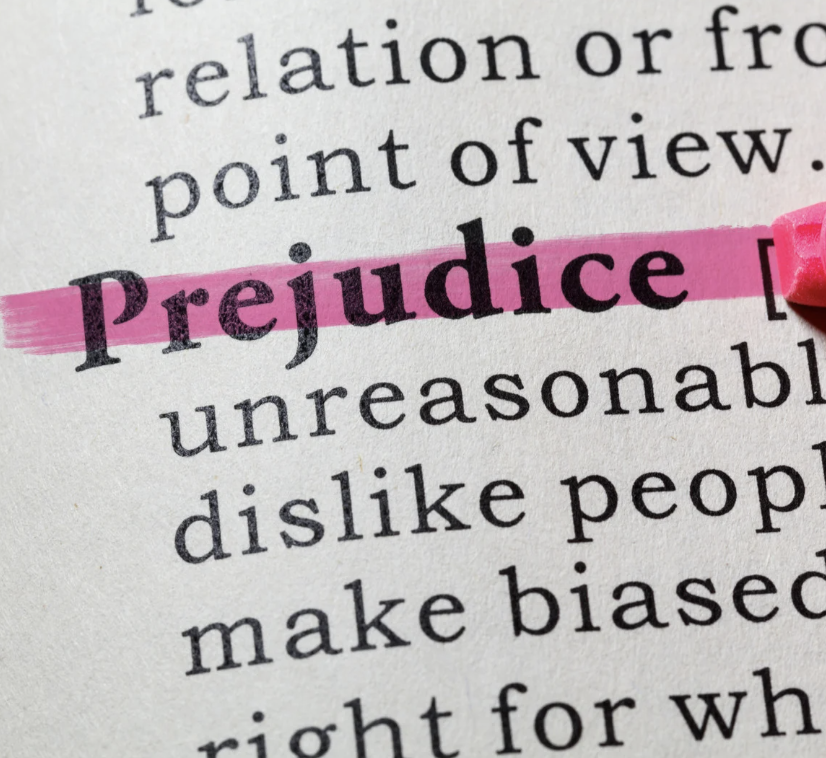
Wenn wir ehrlich sind, glauben die meisten von uns, objektiv zu sein. Wir halten uns für fair, weltoffen und rational; schließlich entscheiden wir nach Fakten, oder? Doch genau hier beginnt das Paradoxon, das die Sozialpsychologin Prof. Dr. Juliane Degner in ihrem Buch „Vorurteile haben doch immer nur die anderen“ so treffend beschreibt: Wir alle haben Vorurteile. Nicht aus Bosheit, sondern aus Gewohnheit.
Unser Gehirn liebt Abkürzungen. Es ist darauf programmiert, in Sekundenbruchteilen Urteile zu fällen: über Menschen, Situationen, Stimmen, Gesichter. Diese unbewussten Denkmuster nennt man Unconscious Bias: Vorurteile, die automatisch ablaufen, ohne dass wir es merken. Sie helfen uns, Komplexität zu bewältigen, aber sie können uns auch in die Irre führen, im Privatleben ebenso wie im Beruf.
Zwischen Intuition und Automatismus
Stell dir vor, du bist in einem Vorstellungsgespräch. Zwei Bewerbungen liegen vor dir. Beide gleich qualifiziert, beide sympathisch. Doch unwillkürlich denkst du: „Irgendwie passt diese Person besser ins Team.“
Diese Art von Bauchgefühl ist in Wirklichkeit selten neutral. Unser Gehirn greift auf gespeicherte Muster zurück, auf vertraute Eindrücke. Wir bevorzugen, was uns bekannt vorkommt.
Dieser Mechanismus wird auch „Affinity-Bias“ genannt. Studien zu Affinity Bias zeigen, dass Menschen unbewusst jene bevorzugen, die ihnen ähnlich sind, in Alter, Sprache, Herkunft oder Geschlecht.
Das Ergebnis: Wir glauben, objektiv zu handeln, obwohl unbewusste Filter längst unsere Entscheidungen prägen.
Diese Art von Bauchgefühl ist in Wirklichkeit selten neutral. Unser Gehirn greift auf gespeicherte Muster zurück, auf vertraute Eindrücke. Wir bevorzugen, was uns bekannt vorkommt.
Dieser Mechanismus wird auch „Affinity-Bias“ genannt. Studien zu Affinity Bias zeigen, dass Menschen unbewusst jene bevorzugen, die ihnen ähnlich sind, in Alter, Sprache, Herkunft oder Geschlecht.
Das Ergebnis: Wir glauben, objektiv zu handeln, obwohl unbewusste Filter längst unsere Entscheidungen prägen.
„Vorurteile haben doch immer nur die anderen!“ Warum dieser Satz so entlarvend ist
Der Titel von Degners Buch ist mehr als eine provokante These. Er ist ein Spiegel. Denn kaum jemand würde offen zugeben, Vorurteile zu haben. Wir distanzieren uns von ihnen, weil wir sie mit Diskriminierung oder moralischem Versagen verbinden.
Doch genau diese Abwehrhaltung verhindert, dass wir sie erkennen. Degner zeigt in ihrer Forschung, dass Vorurteile keine moralische Schwäche, sondern eine menschliche Konstante sind. Unser Gehirn ist darauf angewiesen, komplexe Informationen zu vereinfachen. Es sortiert, bewertet und kategorisiert, oft bevor wir bewusst denken. Das Problem entsteht nicht durch den Bias selbst, sondern dadurch, dass wir ihn ignorieren.
Bewusstwerden ist daher der erste Schritt zu Veränderung. Denn nur wer erkennt, dass auch die eigene Wahrnehmung fehleranfällig ist, kann fairere Entscheidungen treffen – als Individuum, als Führungskraft und als Organisation. Wenn du in deinem Unternehmen lernen möchtest, wie unbewusste Vorurteile erkannt und nachhaltig abgebaut werden können, kannst du hier mehr über unser Unconscious Bias Training. erfahren.
Doch genau diese Abwehrhaltung verhindert, dass wir sie erkennen. Degner zeigt in ihrer Forschung, dass Vorurteile keine moralische Schwäche, sondern eine menschliche Konstante sind. Unser Gehirn ist darauf angewiesen, komplexe Informationen zu vereinfachen. Es sortiert, bewertet und kategorisiert, oft bevor wir bewusst denken. Das Problem entsteht nicht durch den Bias selbst, sondern dadurch, dass wir ihn ignorieren.
Bewusstwerden ist daher der erste Schritt zu Veränderung. Denn nur wer erkennt, dass auch die eigene Wahrnehmung fehleranfällig ist, kann fairere Entscheidungen treffen – als Individuum, als Führungskraft und als Organisation. Wenn du in deinem Unternehmen lernen möchtest, wie unbewusste Vorurteile erkannt und nachhaltig abgebaut werden können, kannst du hier mehr über unser Unconscious Bias Training. erfahren.
Wenn Bias auf die Arbeitswelt trifft
In Unternehmen wirken unbewusste Vorurteile besonders stark, oft unbemerkt, aber mit spürbaren Konsequenzen.
Ein Beispiel: Wenn in einem Meeting immer dieselben Stimmen gehört werden, liegt das selten an fehlender Kompetenz. Häufig spielen Wahrnehmungsfilter eine Rolle, etwa die unbewusste Annahme, dass Extrovertierte automatisch durchsetzungsstärker oder fähiger sind.
Auch im Recruiting sind die Effekte messbar. Zahlreiche Studien zu Bias im Recruiting belegen, dass Bewerbungen mit „fremd klingenden“ Namen oder Kopftuch seltener zu einem Vorstellungsgespräch führen – bei gleicher Qualifikation.
Ebenso zeigt sich, dass Frauen in technischen Berufen oder ältere Bewerber in Start-ups oft benachteiligt werden.
Diese Mechanismen sind selten böswillig. Sie entstehen, weil unser Gehirn unbewusst Muster sucht, die „passen“. Doch dadurch werden ganze Gruppen systematisch übersehen – und Unternehmen verlieren Potenzial.
Ein Beispiel: Wenn in einem Meeting immer dieselben Stimmen gehört werden, liegt das selten an fehlender Kompetenz. Häufig spielen Wahrnehmungsfilter eine Rolle, etwa die unbewusste Annahme, dass Extrovertierte automatisch durchsetzungsstärker oder fähiger sind.
Auch im Recruiting sind die Effekte messbar. Zahlreiche Studien zu Bias im Recruiting belegen, dass Bewerbungen mit „fremd klingenden“ Namen oder Kopftuch seltener zu einem Vorstellungsgespräch führen – bei gleicher Qualifikation.
Ebenso zeigt sich, dass Frauen in technischen Berufen oder ältere Bewerber in Start-ups oft benachteiligt werden.
Diese Mechanismen sind selten böswillig. Sie entstehen, weil unser Gehirn unbewusst Muster sucht, die „passen“. Doch dadurch werden ganze Gruppen systematisch übersehen – und Unternehmen verlieren Potenzial.
Unconscious Bias: Die unsichtbare Macht der Kultur
Organisationskultur ist das, was passiert, wenn niemand hinschaut. Sie zeigt sich in Zwischentönen, in Gesten, in der Art, wie wir zuhören oder eben nicht.
Unconscious Bias beeinflusst diese Kultur stärker, als vielen bewusst ist. Wenn zum Beispiel in Führungsetagen vor allem Menschen mit ähnlichen Hintergründen sitzen, wirkt das auf andere Mitarbeitende wie ein unausgesprochenes Signal: „So sieht Erfolg hier aus.“ Dadurch entstehen unbewusste Erwartungen und Selbstbilder, die Vielfalt einschränken.
Eine inklusive Kultur entsteht nicht automatisch, sondern durch kontinuierliche Reflexion. Sie braucht Führungskräfte, die bereit sind, eigene Annahmen zu hinterfragen und Strukturen, die Chancengleichheit ermöglichen.
Unconscious Bias beeinflusst diese Kultur stärker, als vielen bewusst ist. Wenn zum Beispiel in Führungsetagen vor allem Menschen mit ähnlichen Hintergründen sitzen, wirkt das auf andere Mitarbeitende wie ein unausgesprochenes Signal: „So sieht Erfolg hier aus.“ Dadurch entstehen unbewusste Erwartungen und Selbstbilder, die Vielfalt einschränken.
Eine inklusive Kultur entsteht nicht automatisch, sondern durch kontinuierliche Reflexion. Sie braucht Führungskräfte, die bereit sind, eigene Annahmen zu hinterfragen und Strukturen, die Chancengleichheit ermöglichen.
Die Rolle von Führung und HR
Führungskräfte sind Multiplikatoren. Ihre Wahrnehmung prägt, wie Teams funktionieren, wie Leistung bewertet wird und wer sichtbar bleibt. Deshalb ist es entscheidend, dass sie Bias nicht als „persönliches Problem“ betrachten, sondern als Teil ihrer Führungsverantwortung.
Ein Ansatzpunkt sind Unconscious-Bias-Trainings, die helfen, Denkmuster zu erkennen. Dabei geht es nicht um Schuld, sondern um Bewusstsein. Wenn Führungskräfte verstehen, wie Bias entsteht, können sie Entscheidungsprozesse fairer gestalten, etwa durch objektive Bewertungskriterien, diverse Auswahlgremien oder Feedbackkulturen, in denen verschiedene Perspektiven willkommen sind.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist strukturelle Prävention. Checklisten, anonymisierte Bewerbungen, klare Beförderungskriterien, all das reduziert die Gefahr, dass unbewusste Muster über Erfolg entscheiden. Denn Fairness ist kein Zufall, sondern das Ergebnis bewusster Gestaltung.
Ein Ansatzpunkt sind Unconscious-Bias-Trainings, die helfen, Denkmuster zu erkennen. Dabei geht es nicht um Schuld, sondern um Bewusstsein. Wenn Führungskräfte verstehen, wie Bias entsteht, können sie Entscheidungsprozesse fairer gestalten, etwa durch objektive Bewertungskriterien, diverse Auswahlgremien oder Feedbackkulturen, in denen verschiedene Perspektiven willkommen sind.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist strukturelle Prävention. Checklisten, anonymisierte Bewerbungen, klare Beförderungskriterien, all das reduziert die Gefahr, dass unbewusste Muster über Erfolg entscheiden. Denn Fairness ist kein Zufall, sondern das Ergebnis bewusster Gestaltung.
Vielfalt als Wettbewerbsvorteil
Diverse Teams treffen nachweislich bessere Entscheidungen. Das liegt daran, dass sie mehr Perspektiven vereinen und damit mehr Widerspruch, mehr Diskussion, mehr Reibung erzeugen. Was auf den ersten Blick anstrengend wirkt, führt langfristig zu Innovation.
Doch Vielfalt entfaltet nur dann ihr Potenzial, wenn Unterschiede nicht nur toleriert, sondern aktiv genutzt werden. Wenn Menschen erleben, dass sie mit ihrer individuellen Sichtweise geschätzt werden, entsteht psychologische Sicherheit: das Gefühl, sich ohne Angst einbringen zu können.
Inklusive Organisationen sind lernfähiger, kreativer und widerstandsfähiger. Sie schaffen Räume, in denen Talente wachsen können, unabhängig von Herkunft, Alter, Geschlecht oder Lebensstil.
Das ist keine Idealvorstellung, sondern zunehmend ein Wettbewerbsvorteil. Unternehmen, die Diversität leben, sind besser auf komplexe Märkte und dynamische Veränderungen vorbereitet.
Doch Vielfalt entfaltet nur dann ihr Potenzial, wenn Unterschiede nicht nur toleriert, sondern aktiv genutzt werden. Wenn Menschen erleben, dass sie mit ihrer individuellen Sichtweise geschätzt werden, entsteht psychologische Sicherheit: das Gefühl, sich ohne Angst einbringen zu können.
Inklusive Organisationen sind lernfähiger, kreativer und widerstandsfähiger. Sie schaffen Räume, in denen Talente wachsen können, unabhängig von Herkunft, Alter, Geschlecht oder Lebensstil.
Das ist keine Idealvorstellung, sondern zunehmend ein Wettbewerbsvorteil. Unternehmen, die Diversität leben, sind besser auf komplexe Märkte und dynamische Veränderungen vorbereitet.
Der Blick nach innen: Selbstreflexion als Schlüssel
Unconscious Bias lässt sich nicht „abschalten“. Aber wir können lernen, ihn zu erkennen.
Ein erster Schritt ist, sich im Alltag zu beobachten. Wann urteile ich spontan über jemanden? Welche Bilder oder Erfahrungen beeinflussen mein Denken?
Hilfreich kann der Implicit Association Test (IAT) der Harvard University sein, der unbewusste Assoziationen sichtbar macht. Das Ergebnis mag irritieren, aber genau das ist der Punkt: Bewusstsein entsteht dort, wo wir überrascht werden.
Auch Feedback von Kolleg:innen oder Freund:innen kann wertvoll sein. Oft sehen andere, was uns selbst entgeht. Und manchmal reicht schon die ehrliche Frage: „Wäre meine Entscheidung dieselbe, wenn diese Person anders aussehen, sprechen oder heißen würde?“
Ein erster Schritt ist, sich im Alltag zu beobachten. Wann urteile ich spontan über jemanden? Welche Bilder oder Erfahrungen beeinflussen mein Denken?
Hilfreich kann der Implicit Association Test (IAT) der Harvard University sein, der unbewusste Assoziationen sichtbar macht. Das Ergebnis mag irritieren, aber genau das ist der Punkt: Bewusstsein entsteht dort, wo wir überrascht werden.
Auch Feedback von Kolleg:innen oder Freund:innen kann wertvoll sein. Oft sehen andere, was uns selbst entgeht. Und manchmal reicht schon die ehrliche Frage: „Wäre meine Entscheidung dieselbe, wenn diese Person anders aussehen, sprechen oder heißen würde?“
Der Weg zu einer bewussteren Arbeitskultur
Unconscious Bias ist kein Randthema, sondern eine Frage der Haltung. Eine Organisation, die Vielfalt fördern will, muss sich trauen, Unsichtbares sichtbar zu machen. Das bedeutet, nicht nur auf individuelle Reflexion zu setzen, sondern Strukturen zu verändern:
Auswahlprozesse sollten überprüft und standardisiert werden.
Führungskräfte brauchen Schulungen, um Bias zu erkennen.
Feedbackkulturen sollten Offenheit fördern statt Konformität.
So entsteht Schritt für Schritt eine Kultur, in der Entscheidungen nicht durch Gewohnheit, sondern durch Bewusstsein geprägt sind.
Auswahlprozesse sollten überprüft und standardisiert werden.
Führungskräfte brauchen Schulungen, um Bias zu erkennen.
Feedbackkulturen sollten Offenheit fördern statt Konformität.
So entsteht Schritt für Schritt eine Kultur, in der Entscheidungen nicht durch Gewohnheit, sondern durch Bewusstsein geprägt sind.
Fazit: Bewusstsein statt Perfektion
Unconscious Bias verschwindet nicht durch gute Absichten. Er verliert erst dann seine Macht, wenn wir ihn wahrnehmen. Juliane Degner erinnert uns daran, dass Vorurteile menschlich sind und dass sie uns nicht definieren müssen. Wir alle tragen sie in uns, aber wir können lernen, sie zu erkennen, zu reflektieren und neu zu handeln.
Ob im Recruiting, in der Führung oder im täglichen Miteinander: Echte Veränderung beginnt nicht mit Perfektion, sondern mit Bewusstsein. Denn wer versteht, dass wir erst fühlen und dann denken, kann bewusstere Entscheidungen treffen.
Ob im Recruiting, in der Führung oder im täglichen Miteinander: Echte Veränderung beginnt nicht mit Perfektion, sondern mit Bewusstsein. Denn wer versteht, dass wir erst fühlen und dann denken, kann bewusstere Entscheidungen treffen.
Arbeiten Sie mit uns!
Das sagen unsere Kund*innen

"Providing valuable know-how and hands-on measures."
Würth Group
Robert Friedmann
Chairman of the Board
Chairman of the Board

"Anne implemented our global Unconscious Bias initiative."
Vaillant Group
Sevkan Bolu
Global HR Manager
Global HR Manager

"Bewegt selbst kritische Stimmen zu Reflexion und Umdenken."
Max-Planck-Gesellschaft
Frauke Logermann
Team Lead Talent
Team Lead Talent
Unser Prozess
Auf einen Blick
1
Kontakt aufnehmen
Schreiben Sie uns per E-Mail, rufen Sie uns an oder buchen Sie direkt ein Vorgespräch.
2
Angebot erhalten
Webinar, Präsenztraining, Vortrag oder eLearning – wir erstellen Ihr maßgeschneidertes Angebot.
3
Optimal vorbereitet starten
Zwei Wochen vor dem Training erhalten Sie Vorbereitungsmaterial für alle Teilnehmenden.
4
Training erleben
Praxisnah und interaktiv – lernen Sie mit uns auf Deutsch oder Englisch, online oder in Präsenz.
5
Nachbereitung & Debriefing
Sie erhalten ein Management Summary und wir definieren zusammen nächste Schritte.
Jetzt anfragen →







.svg)








.avif)
.avif)